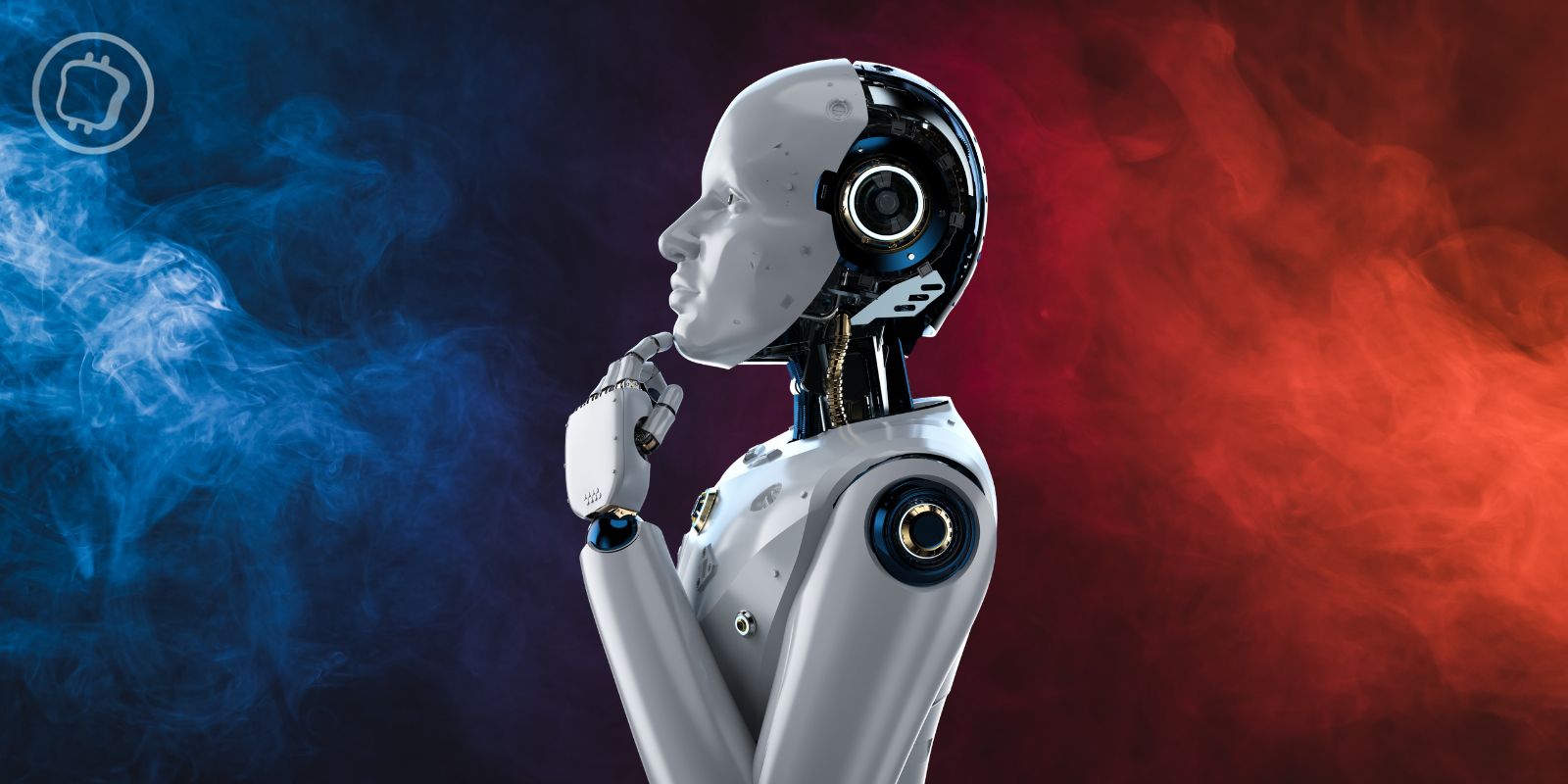Es gehört zum Schrecken des Krieges, dass wir von einem Zeitpunkt an nahezu aufhören, über einzelne Menschen zu sprechen, und nur noch größere Zusammenhänge in den Blick nehmen. Dann kommen Armeesprecher zu Wort, die von Fortschritten und Rückschlägen militärischer Operationen berichten, und Staatslenker, die Nationen um Solidarität, Geld oder Waffen bitten, und schließlich sprechen Fachleute für Militär und die jeweilige Region im TV und Radio, loten aus, wie lange die Kampfhandlungen mutmaßlich noch andauern, wie die Erfolgschancen der Konfliktparteien einzuordnen sind, analysieren Frontverläufe und Angriffsstrategien und unter welchen Bedingungen Feuerpausen und Waffenstillstandsabkommen verhandelbar sind.
Und täglich hören wir neue, höhere Opferzahlen. Das klingt dann alles sehr abstrakt und technisch, völlig unblutig und gesichtslos, so sehr, dass auch wir selbst irgendwann mit diesen Worten, die den Krieg beschreiben sollen und doch wenig über ihn aussagen, tagtäglich im Büro oder am Esstisch jonglieren, ohne dass uns das nackte Grauen, das sie eigentlich bezeichnen, den Rücken hinaufkriecht.