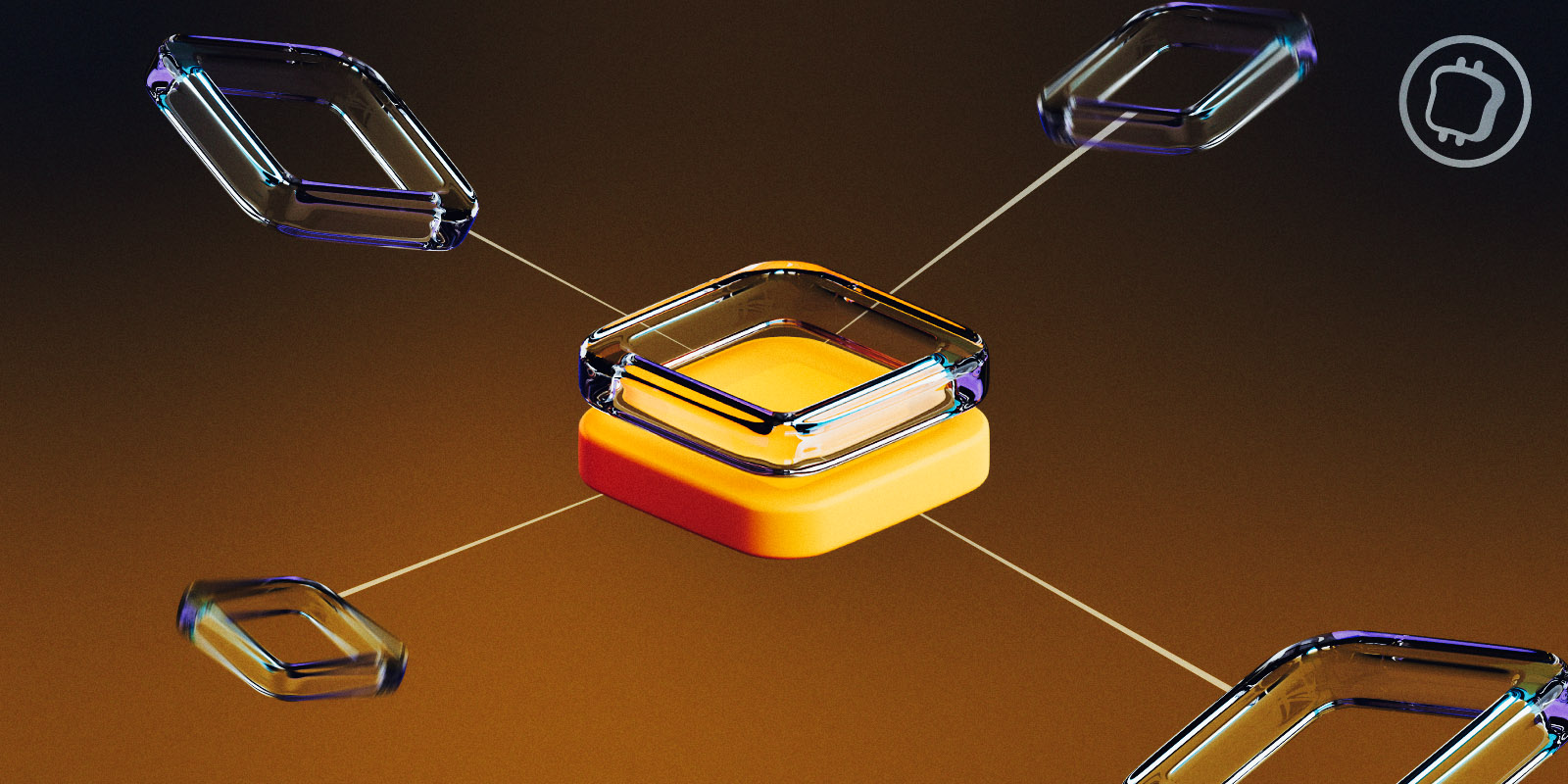Gerhard Schröder, einem „Enkel“ des heiligen Willy Brandt, war selbst nie etwas heilig. Er verfolgte als Politiker nie ein stringentes Prinzip. Er blieb stets flexibel und achtete auf die Stimmung im Land. Umso überraschender mag erscheinen, dass Schröder jetzt, nach dem Ende seiner politischen Karriere, vor allem durch seine unverbrüchliche, man könnte auch sagen sture und gefährliche Loyalität zu Russlands Herrscher und Kriegsherren Wladimir Putin auffällt.
Wobei das vielleicht gar kein Widerspruch ist. Denn Schröder war sich schon immer selbst Prinzip genug. Selbstzweifel kennt er offenbar nicht – so sagt er es, und man glaubt es ihm. Im Interview mit der „New York Times“ brachte er es vor zwei Jahren auf den Punkt: „Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa.“
Das war der Moment, an dem die SPD beschloss, endgültig mit Schröder zu brechen. Man versuchte ihm das Büro im Bundestag zu streichen. Ob das gelingt, muss ein Gericht noch abschließend klären. Man versuchte ihn aus der Partei zu werfen – was nicht gelang. Das nie einfache, selten gute Verhältnis zwischen SPD-Kanzler und SPD erreichte so einen traurigen Höhepunkt. Seinen 70. Geburtstag feierte er noch mit einem großen Empfang, auf dem der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel sprach. Nun, zum nächsten runden Geburtstag, ist schon die Frage ein Politikum, ob man Schröder gratulieren soll. Kein Politiker seines Rangs ist im öffentlichen Ansehen jemals so abgestürzt.
Die Ablehnung des Irak-Kriegs kam gut an
Dabei war für die SPD Schröders enges Verhältnis zu Russland lange Zeit kein großes Problem. Auch nicht seine Politik, die den Weg in die Energieabhängigkeit ebnete. Schröder füllte mit Realpolitik aus, was in der SPD lange Konsens war: Ein gutes Verhältnis zu Moskau sei notwendig, um den Frieden in Europa zu erhalten. Der Irakkrieg bot eine gute Gelegenheit, die Russlandfreundschaft zudem mit antiamerikanischen Parolen zu garnieren, die Schröder schon als Juso-Mann in den Siebzigerjahren beherrschte. In der SPD kam das gut an. Kein Wunder, dass sie Schröder das auch bis heute nicht vergessen: das deutsche Nein gegenüber George W. Bush.
Noch 2017 ließ Kanzlerkandidat Martin Schulz der SPD ins Wahlprogramm schreiben, dass das Zweiprozentziel der NATO „falsch und unsinnig“ sei. Schulz spannte Schröder auch für den Wahlkampf ein. Den Bau der ersten Nord-Stream-Pipeline, den Schröder politisch vorbereitete, vollendete die nachfolgende große Koalition unter der CDU-Kanzlerin Angela Merkel allzu gerne. Bundeswirtschaftsminister Michael Glos, ein CSU-Mann, widmete seine erste Auslandsreise dem Start des Pipelineprojekts.
Die Kommentare aus der SPD zu Schröders Engagement im russischen Energieimperium, das er wenige Stunden nach dem Ausscheiden aus dem Amt übernahm, lassen sich so zusammenfassen: nicht gut, aber Schröders Privatangelegenheit. Überhaupt wollte man den Alt-Kanzler möglichst schnell zum Rubel- statt Russlandversteher werden lassen. Denn die Wunden, die Schröder der SPD zugefügt hatte, waren noch frisch. Die von Schröder initiierten Agenda-Reformen galten Partei und Gewerkschaften als Sündenfall, als Verrat an der eigenen Klientel und Ursache diverser Wahlabstürze. Gleichwohl erzielte die SPD mit Schröder im Vergleich zu heute grandiose Wahlergebnisse: 1998 40,9 Prozent, 2002 38,5 Prozent und bei der Wahlniederlage 2005 noch 34,2 Prozent.
Parallelen bei Schröder und Scholz
Dabei hatte Schröder schon als niedersächsischer Landespolitiker kein Hehl daraus gemacht, dass er den Sozialstaat umbauen wolle. 1990 eroberte er die Staatskanzlei in Hannover, seiner Heimatstadt, und baute ein Netzwerk auf, das ihn über Jahrzehnte tragen sollte. Der Jurist Schröder war ein Medienmann. Er plante seine Karriere nicht über die politischen Gremien, sondern über das Fernsehen und die Zeitungen. Schröders Talent stach heraus.
1998 bereitete ein gesellschaftliches Gefühl den Wahlsieg Schröders vor: die Angst der Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg. Es war ein Gefühl, das dem heutigen nicht unähnlich war. Schröder schuf eine „neue Mitte“, er zielte dabei auf die Grenzschicht zwischen Union und SPD. Das wiederum sollte Angela Merkel später ebenfalls tun, und auch Olaf Scholz schielte auf diese Gruppe von Wählern.
Erstaunlich sind die Parallelen der ersten Amtsmonate von Schröder und Scholz. Sie sind von Kriegen geprägt. Schröder schickte zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutsche Soldaten in einen Kampfeinsatz. Die Ablehnung von Scholz, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu liefern, wurde von Schröder gelobt und von einigen Beobachtern mit dessen Nein zum Irak-Einsatz verglichen. Schröder lehnt das ab. In diese Reihe will er offenbar nicht gestellt werden.
Die SPD würde Schröder am liebsten aus ihrer Geschichte verschwinden lassen. Aber er prägte sie über viele Jahre. Er machte sie zur Mittepartei. Überwunden schien alle Ideologie, es gab nur noch gute oder schlechte Politik. Als Scharnierpartei eröffneten sich der SPD so neue Koalitionsoptionen. Aber sie verlor auch Profil und Eindeutigkeit. Das sollte ein großes Problem für die SPD nach Schröder werden. Auf die Frage, wer sie eigentlich sei und was sie wolle, konnte sie ohne den Alphamann Schröder lange keine Antwort geben.
Ob Schröder das Genugtuung verschafft, ist ungewiss. Dass er an der Provokation Freude hat, ist bekannt. Die aktuelle SPD-Führung hält er für leichtgewichtig und dilettantisch. Schröder, der nie die Parteitraditionen pflegte, ärgert seine Partei deswegen besonders, wenn er immer wieder beteuert: Er ist und bleibe Sozialdemokrat. An diesem Sonntag wird Gerhard Schröder 80 Jahre alt.