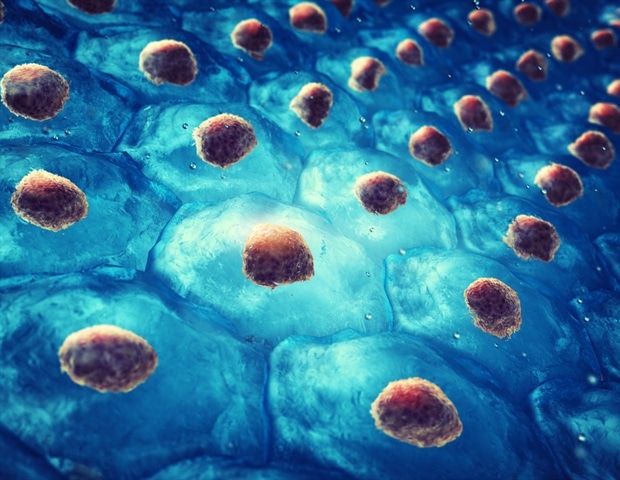Zwar sollen die Fallpauschalen, mit denen aktuell tatsächlich pro Behandlung abgerechnet wird, teilweise abgeschafft und durch Vorhaltepauschalen ergänzt werden. Es müsste dann nicht mehr unbedingt brennen, damit Geld reinkommt. Bähner aber sieht es so: Krankenhäuser, die schon heute Auslastungen von 90 Prozent erreichten und ihre Patienten ohnehin immer schneller entließen, sollten nun noch mehr auf Effizienz getrimmt werden. „Das Fundament Gesundheitsversorgung wird nachhaltig zerstört“, sagt er.
Große medizinische Zentren wie Unikliniken sollen gestärkt werden, viele kleine Krankenhäuser dürften infolge der Krankenhausreform schließen oder in kleinere Medizinische Versorgungszentren umgewandelt werden. Das soll nicht nur Kosten senken, sondern auch die Qualität der Behandlungen verbessern, so das Versprechen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Denn da, wo ein Eingriff oft durchgeführt wird, so die Logik, passieren weniger Fehler.

„Natürlich ist es richtig, dass ein Krankenhaus mit 50 Betten keine Pankreasresektionen durchführen sollte“, sagt Bähner. „Aber die Masse der Menschen auf dem Land stirbt nicht während einer Pankreasresektion, sondern an alltäglichen Erkrankungen wie an einer Lungenentzündung, am Herzinfarkt oder einem Schlaganfall“, sagt Bähner. „Es ist eine Illusion, dass die großen Zentren in der Krankenhauslandschaft ausreichen, um diese Versorgung sicherzustellen. Was ist mit den Menschen im Altersheim in der Eifel, die man eineinhalb Stunden bis zum nächsten Intensivbett nach Köln fahren muss?“ Bähner schüttelt den Kopf, während er spricht. Wie er lehnen viele Ärzte die Reform ab.
Notfallmedizin gerät unter Druck
Schon heute gehören weite Wege für Notfallpatienten zum Alltag. Der Intensivmediziner Bähner fährt gelegentlich Notarztdienste in der Region um Andernach im Norden von Rheinland-Pfalz. Hat er einen Patienten stabilisiert, muss er eine Dreiviertelstunde im Krankenwagen transportiert werden. Künftig womöglich noch länger. „Das geht nicht“, sagt Bähner und fasst sich an die Stirn. Bei einem Herzinfarkt zähle jede Minute, um zu verhindern, dass Gewebe abstirbt. Was der Arzt aus Andernach beschreibt, ist kein Problem allein der Eifel. Alle Regionen fernab der medizinischen Maximalversorger sind damit konfrontiert.
Die Krankenhausreform soll steigende Kosten im Gesundheitssystem unter Kontrolle bringen. Es wird unweigerlich weniger Krankenhäuser in der heutigen Form geben, sagen Gesundheitsökonomen. Die Idee ist, dass Patienten noch mehr als heute dorthin kommen, wo die Diagnostik und die Behandlungsmöglichkeiten am besten sind. Bähner hält es für falsch, dass instabile Intensivpatienten über weite Strecken transportiert werden.
Jede Minute des Transportes belaste den Patienten zusätzlich und lasse die Wahrscheinlichkeit sinken, dass er überlebt. Hinzu kommen bei den Krankentransporten ganz praktische Probleme: Wenn der eine Krankenwagen, der planmäßig in Andernach im Einsatz ist, über Stunden einen Patienten in ein Zentrum fährt, müssen andere Notarztbezirke aushelfen. Das funktioniert laut Bähner meist, aber die Versorgung sei eingeschränkt.
Alle wissen, dass es so nicht weitergeht
So wie es ist, kann es nicht weitergehen. Darüber wären sich Torsten Bähner und Karl Lauterbach wohl einig. Deutschland leistet sich eines der teuersten Gesundheitssysteme weltweit, die Behandlungsergebnisse sind aber laut Studien schlechter als in Nachbarländern. Die Krankenkassen ächzen unter den Kosten. Viele Krankenhäuser fahren Verluste ein. Mal tragen das Kommunen, mal Bundesländer, mal sind es private Eigentümer, die in der Folge einen Sparkurs durchsetzen oder den Betrieb einstellen. In Rheinland-Pfalz schlossen seit 2020 acht Krankenhäuser, zwei weitere befinden sich in Umstrukturierung, die Träger wollen die Standorte nicht weiterführen.
Das St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach sieht sich zwar nicht bedroht, ist aber wie drei von vier Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz defizitär. Mit 274 Betten entspricht es ziemlich genau dem durchschnittlich großen Krankenhaus in Deutschland. Den Fehlbetrag übernimmt die gemeinwohlorientierte Stiftung, der das Haus gehört.
Die Parteifreunde, um die Lauterbach kämpfen muss
Für Clemens Hoch, den Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz von der SPD, ist es ein Alarmsignal, dass ein Haus, das aus seiner Sicht sehr gut geführt wird, nicht wirtschaftlich haushalten könne. Hoch stimmte wie alle seine Kollegen in den Gesundheitsministerien der Länder vergangenes Jahr gegen den Entwurf der Krankenhausreform. Seitdem ist einiges passiert. Heute sagt Hoch: „Wir brauchen die Krankenhausreform.“
Wie kam es zu dem Sinneswandel?
Anfang September kommt Bundesminister Lauterbach nach Rheinland-Pfalz, um seine Aufwartung zu machen. Er will die sozialdemokratisch regierten Bundesländer für sich gewinnen. So halten vor der Pathologie der Universitätsmedizin Mainz zwei wuchtige Dienstlimousinen. Lauterbach steigt aus und umarmt seinen Landeskollegen Hoch, begrüßt Ministerpräsident Alexander Schweitzer herzlich.

Eine Dreiviertelstunde spazieren die drei über das Klinikgelände. Lauterbach plaudert mit Ärzten, der Verantwortlichen für Pflege und Vorständen der Unimedizin. Meist stellt Lauterbach eine kurze Frage, um dann in großes Lob überzugehen: Dass die Abbrecherquote in der Pflege in Mainz bei nur zehn Prozent liege, das sei „sehr sehr gut“. „Hier wird sehr viel richtig gemacht.“ In der Onkogenetik nehme Mainz eine „führende Position ein“.
Dem Vorstandsvorsitzenden der Universitätsmedizin gibt er noch den Ratschlag, die Studienordnung anzupassen – man müsse stärker auf Kombinationsstudiengänge aus Medizin und Mathematik oder Informatik setzen. All das typisch Lauterbach: freundlich, inhaltlich durchaus fundiert, wie ein anwesender Arzt sagt, aber auch ein wenig von oben herab.
Karl Lauterbach polarisiert: „Irgendwie cool“
Dass die Stimmung zwischen dem Land und der Universitätsmedizin so gut ist, hat mit einer jüngsten Entscheidung zu tun, dass die chronisch unterfinanzierte Klinik entschuldet werden und insgesamt mehr Geld aus dem Landeshaushalt bekommen soll. Lauterbach lobt das Miteinander von Land, Klinik und Forschung als „großartig“.
Die Universitätsklinik in Mainz sei „wie gemacht für die Krankenhausreform“. Sie soll nach dem Willen des Ministers mehr Geld bekommen, dafür vor allem komplizierte Fälle übernehmen und einfache Fälle an kleinere Häuser schicken. Nur haben diese kleineren Häuser Zweifel, dass sie durch die versprochenen Vorhaltepauschalen ihre Kosten decken können.
Auf dem Campus der Mainzer Unimedizin kommen Auszubildende auf Lauterbach zu, wollen Selfies machen. Ein angehender Pfleger sagt, Lauterbach sei „irgendwie cool“. Der Mann sagt, Lauterbach sei der erste Gesundheitsminister, den er beim Namen kenne, und lacht.

Am Ende des Rundgangs verschwindet Lauterbach mit den Landespolitikern Schweitzer und Hoch zu Gesprächen, von denen es später heißt, dass man sich habe annähern können. Lauterbach will auf Rheinland-Pfalz und andere sozialdemokratisch regierte Länder in bestimmten Punkten zugehen, dafür sollen sie das Gesetzesvorhaben im Bundesrat unterstützen. Lauterbach will verhindern, dass es dort eine Zweidrittelmehrheit gegen seine Reform gibt. Das hätte zur Folge, dass der Vermittlungsausschuss angerufen würde. Eine dortige Einigung bis zur Bundestagswahl in einem Jahr gilt als unwahrscheinlich und könnte das Aus der Reform bedeuten.
Die unionsgeführten Länder lehnen das Vorgehen Lauterbachs grundsätzlich ab, sie halten das Gesetz für zustimmungspflichtig: Es müsste danach eine Mehrheit im Bundesrat erhalten, weil es in die Haushalte und die Krankenhausplanungen der Länder eingreift. Auch im Kreis der SPD-geführten Bundesländer ist man skeptisch, es heißt, dass Lauterbach manche Zusagen, die er im persönlichen Austausch gemacht habe, nicht in Gesetzesform umgesetzt habe. Manche waren verärgert. Und dennoch hat es zuletzt wieder Annäherungen gegeben.
Ein Teil der Unzufriedenheit landet immer beim Minister
Im St. Nikolaus-Stifthospital in Andernach hängt ein Bild von Lauterbach. Es ist kein gerahmtes Porträt, wie man es vom Bundespräsidenten in Behörden kennt. Lauterbach ist laminiert. Ebenso wie ein kleiner Ölzweig und zwei Glückskekssprüche, einer lautet: „Sie haben die richtige Richtung eingeschlagen“. So wacht Lauterbach über den Eingangsbereich des Herzkatheterlabors. Hört man den Mitarbeitern zu, die über die strukturellen Probleme des Gesundheitssystems klagen, merkt man, dass sie nicht alles Lauterbach anlasten. Aber ein Gesundheitsminister bekommt immer einen Teil der Unzufriedenheit ab.
Anke Türoff, Chefärztin der Notaufnahme, macht eine wegwischende Handbewegung. Bevor Herr Lauterbach eine große Reform auf den Weg bringe, müssten die Grundlagen stimmen. Was sie meint, kann sie an diesem Mittag auf ihrer Station zeigen. In Behandlungsraum drei liegt ein Mann Ende 70, der alle vier bis sechs Wochen hierher kommt. Wieder mal ging es ihm nicht gut. Er hatte an diesen heißen Septembertagen zu wenig getrunken, bekam deshalb eine Infusion. Seine Blase wurde entlastet.
Türoff fragt ihn nun, wie es mit dem Wasserlassen klappe. Alles bestens, sagt er. Während er wissen möchte, wann er nach Hause kann, stellt die Ärztin weitere Fragen. Mit dem Sohn des Mannes, der in der Schweiz lebt, hat sie schon oft gesprochen. Das ist nicht Türoffs Aufgabe, aber es macht sonst keiner.
„Notaufnahmen sind zentrale Anlaufstellen für Patienten, die nicht ausreichend versorgt werden – durch Pflege oder Angehörige, durch den Hausarzt oder den Facharzt, bei dem sie erst in Monaten einen Termin bekommen. Was draußen medizinisch ausbleibt, das müssen wir übernehmen“, sagt Türoff. Dabei sind Notaufnahmen eigentlich für Notfälle wie Schlaganfälle und Herzinfarkte entstanden. Lauterbach kennt das Problem, sein Ministerium will mit einer Reform der Notfallversorgung gegensteuern. Ob diese hält, was der Minister verspricht, werden die kommenden Jahre zeigen.
Der zu einfache Weg in die Notaufnahme
Türoff läuft zum Stützpunkt, einem Raum, in dem auf einem Computerbildschirm steht, wen sie als Nächstes behandeln soll. Dem Manchester-Triage-System entsprechend, führt ein geschulter Pfleger mit jedem, der sich in der Notaufnahme meldet, ein Erstgespräch, um die Dringlichkeit einzuschätzen. Die Farben reichen von Rot („sofort“) über Orange („sehr dringend“), Gelb („dringend“) hin zu Grün („normal“). Die meisten Fälle sind an diesem Dienstagmittag gelb.
Im Schockraum sitzt ein Mann Ende 60, der über stark geschwollene Knöchel klagt. Der Hausarzt hat ihn ins Krankenhaus geschickt. Was bislang untersucht wurde und wieso genau überwiesen wurde, kann Türoff auf dem Zettel des niedergelassenen Kollegen nicht erkennen. Häufig kommen die Patienten mit unvollständigen Unterlagen. Türoff muss den Hausarzt anrufen. „Aber bei fünf bis zehn parallel zu versorgenden Patienten habe ich dafür keine Zeit“, sagt Türoff. Sie versucht es trotzdem, schaut auf die Uhr, Mittagszeit, wahrscheinlich erreicht sie in der Praxis niemanden. Der Empfang soll es weiter probieren.

Türoff ist freundlich, stellt viele Fragen und lässt einiges abklären. Am Ende sagt sie: „Keiner der Patienten, die wir heute gesehen haben, stirbt nach jetzigem Stand in den nächsten 48 Stunden oder sogar der nächsten Woche.“ Die einen Patienten kämen, weil sie die Erwartung hätten, dass ihr medizinisches Problem zu dem von ihnen gewünschten Zeitpunkt behandelt werde, andere scheiterten schlicht an der ambulanten Versorgung, die nach Türoffs Eindruck nicht ausreichend ist. Es ist ein Problem, das durch weniger kleine Krankenhäuser in der Fläche noch größer werden könnte.
Der Minister will das ganze System modernisieren
Jedes Krankenhaus, das schließt, löst Sorgen in der Bevölkerung aus. In Adenau, mit knapp 3000 Einwohnern laut Landesplanung Mittelzentrum, schloss voriges Jahr ein Krankenhaus mit rund 70 Betten und zuletzt 55 Vollzeitkräften. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch zeigt Verständnis für Ängste der Bürger, sagt aber auch, dass man in 30 Minuten nun in Bad-Neuenahr oder Mayen sei, wo „objektiv eine bessere Versorgung angeboten wird als in einem kleinen Haus“. Kein medizinisches Problem werde gelöst, wenn allein über die Zahl der Krankenhäuser diskutiert wird, findet Hoch.
Hoch vergleicht das deutsche System mit dem der Niederlande. Dieses gilt als schlanker, günstiger und effizienter. Hoch erzählt davon, dass man dort nicht in die Notaufnahme spazieren könne. Man müsse immer erst eine Telefonnummer wählen, werde von einem sogenannten Triageassistenten befragt; Ähnliches schwebt Lauterbach für Deutschland vor.
Aufgrund der Bürger-Identifikationsnummer liegen dem Assistenten alle Befunde und Unterlagen des Patienten vor. Im Zweifel bekommt man dort beim Hausarzt am nächsten Tag einen Termin. „Wenn es ernster ist, haben sie noch am gleichen Tag einen Termin im Krankenhaus“, sagt Hoch. In Deutschland, wo die elektronische Patientenakte gerade auf den Weg kommt, stünde einem solchen Szenario nicht nur der Datenschutz im Weg, so Hoch, sondern auch, dass viele Hausärzte keine elektronischen Termine vergeben. Es fehle an effizienter Patientensteuerung.
Dem SPD-Politiker geht es um die Frage, was der Gesellschaft die Gesundheitsversorgung wert ist. Denn zur Wahrheit gehört aus seiner Sicht auch, dass Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz den Niederlanden während der Pandemie mit Krankenhausbetten ausgeholfen haben, sonst hätte es ein großes Problem gegeben. „Das ist der Preis eines schlankeren Gesundheitssystems.“
Viele kleine Streitpunkte, viele offene Fragen
Der Landesminister will eine Art Zwischenweg einschlagen. Nicht alle Krankenhäuser würden in der jetzigen Form im Land erhalten bleiben. „Aber überall dort, wo heute ein Krankenhaus ist, soll es auch weiterhin zumindest einen Standort für medizinische Versorgung geben“, sagt Hoch. Er meint die Schaffung von Medizinischen Versorgungszentren oder Level-1i-Häusern, in die bestehende kleine Krankenhäuser umstrukturiert werden könnten. Seit Jahren wirbt Hoch bei den Trägern dafür. Freiwillig wollte aber bislang keiner die Schrumpfung vornehmen. Durch die Krankenhausreform soll es dafür mehr Geld durch den angelegten Transformationsfonds geben.
Die Idee ist, dass ein Level-1i-Haus einige Betten hat und beispielsweise ältere Patienten, die dehydriert sind oder eine Blasenentzündung haben, für drei bis vier Tage aufnehmen und pflegen kann. Wohnortnahe Versorgung ergänzt die Behandlung komplexer Erkrankungen in medizinischen Zentren. In der Krankenhausreform wird das Konzept ausdrücklich aufgeführt und kann durch die Schaffung von Facharztsitzen gestärkt werden. Eine Verschränkung der ambulanten Praxen und des stationären Systems soll kleine defizitäre Krankenhäuser ersetzen.
Ärzte wie Torsten Bähner bemängeln, dass in diesen Level-1i-Häusern keine Weiterbildung stattfinden könne und sich deshalb keine Assistenzärzte fänden, die es für den 24-Stunden-Betrieb brauche. Der Gesundheitsökonom Boris Augurzky vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung RWI versteht die Kritik nicht, der Assistenzarzt könne doch neben den Kliniken auch in den kleinen Häusern Station machen. „Die Weiterbildung, wie sie in Deutschland bislang praktiziert wird, ist kein Naturgesetz.“
Es ist eines von vielen Beispielen, die zeigen, dass die Veränderungen im Gesundheitssystem mit vielen kleinen Streitfragen einhergehen. Derzeit befinden sich die von der SPD regierten Länder im Austausch mit Lauterbach, der ihre Zustimmung will. Sie sind nur „halb zufrieden“, wie es heißt. Nach F.A.Z.-Informationen ist es allerdings wahrscheinlich, dass Lauterbach diese Länder auf seine Seite bekommt.
Keine Reform ist für die Länder auch keine Lösung
Die Länder brauchen eine Reform. Der CDU-Gesundheitspolitiker Torsten Welling, Mitglied des Mainzer Landtags, hält die Krankenhausreform für praktisch alternativlos. Wenn sie nicht komme, sei das „der Untergang der rheinland-pfälzischen Kliniklandschaft“. Aus seiner Sicht habe das Bundesland allzu lange auf den Bund gewartet und die Dinge laufen lassen. Derzeit finde ein „planloses Krankenhaus-Sterben“ statt, eine Entwicklung, die sich nur schwer zurückdrehen lasse.
Wenn Träger der Krankenhäuser sparen wollen, schließen sie oft erst mal die defizitären Abteilungen. Die Geburtshilfe arbeitet selten kostendeckend. Weil in der Region um Andernach immer mehr Häuser ihr Angebot einstellten, werden im St. Nikolaus-Stifthospital inzwischen pro Jahr mehr als tausend Geburten durchgeführt. Für ein kleines bis mittelgroßes Krankenhaus ist das eine riesige Zahl. Die Krankenhausreform sieht Zuschläge für Geburtenstationen vor.
Die Geschäftsführerin des Andernacher Krankenhauses, Cornelia Kaltenborn, beklagt wie viele Klinikmanager aber ein grundsätzliches Problem, das auch durch die Reform nicht behoben werde: eine chronische Unterfinanzierung. „Es klafft eine Lücke zwischen dem, was wir für unsere Leistungen bekommen, und dem, was wir bedingt durch Tarif- und Inflationssteigerungen zahlen müssen“, sagt sie. Die Gehälter seien um acht Prozent gestiegen, der Landesbasisfallwert, mit dem vergütet wird, nur um vier Prozent.
Die Reform könnte durchaus eine Linderung bedeuten. Stärker als bisher profitieren besonders kleinere bis mittelgroße Häuser wie in Andernach davon, dass sie stärker durch Vorhaltepauschalen für die Daseinsvorsorge bezahlt werden, nicht wie bisher für jeden einzelnen Patienten.
Gesundheitsökonom Augurzky sieht eine Gefahr darin, dass die Reform, falls sie beschlossen wird, erst 2027 ihre Wirkung zeigen dürfte. Der kalte Strukturwandel, der nicht nur durch Rheinland-Pfalz zieht, könnte bis dahin zu vielen Schließungen führen. Augurzky und seine Kollegen haben ausgerechnet, was es kosten würde, das Gesundheitssystem in seiner jetzigen Form bis 2030 zu stabilisieren. Insgesamt 14 Milliarden Euro, keine Transformation eingerechnet. Doch Augurzky argumentiert, dass viel Geld keine Probleme löse. Es brauche zwar Stabilisierungsgelder, aber der wirtschaftliche Druck auf die Krankenhäuser dürfe nicht ganz verschwinden. Sonst sähen die keinen Anlass, sich zu verändern.